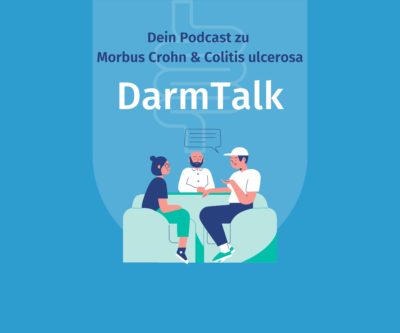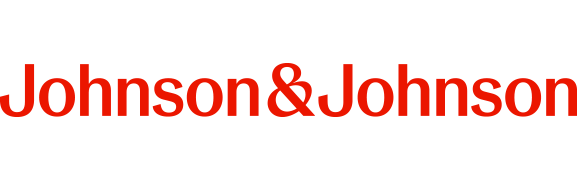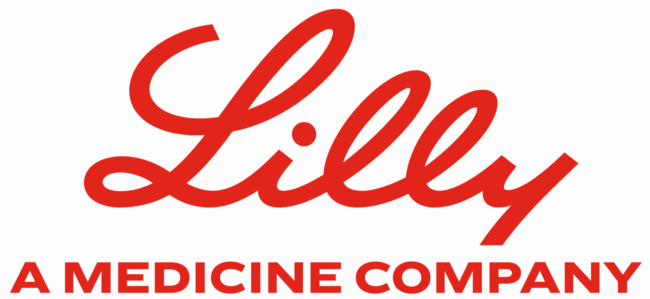Kurzdarmsyndrom bei CED: Wenn der Darm zu kurz wird
Der Dünndarm ist bei gesunden Erwachsenen etwa fünf bis sechs Meter lang. Seine Hauptaufgabe ist die Aufnahme von Nährstoffen, Flüssigkeit und Elektrolyten. Verbleiben weniger als etwa 25 – 30 % des Dünndarms, kann die normale Verdauungs- und Resorptionsfunktion nicht mehr ausreichend gewährleistet werden – es entsteht ein Kurzdarmsyndrom.
Was ist ein Kurzdarmsyndrom?
Das Kurzdarmsyndrom (engl. Short Bowel Syndrome) ist eine Form des Darmversagens. Es entsteht, wenn große Teile des Dünndarms entfernt werden müssen – zum Beispiel bei schweren Verläufen von Morbus Crohn, bei Darmtumoren, Durchblutungsstörungen des Darms (z. B. Mesenterialinfarkt) oder nach Unfällen. In seltenen Fällen ist die Ursache angeboren.
Wie entsteht ein Kurzdarmsyndrom bei CED?
Bei Chronisch Entzündlichen Darmerkrankungen (CED), insbesondere Morbus Crohn, kann es durch wiederholte Entzündungen, Engstellen oder Fisteln notwendig sein, große Abschnitte des Darms operativ zu entfernen. In seltenen Fällen führt dies zu einem Kurzdarmsyndrom – insbesondere, wenn bereits frühere Eingriffe erfolgt sind oder mehrere Darmabschnitte betroffen sind.
Formen des Kurzdarmsyndroms
Je nach verbleibender Darmstruktur unterscheidet man mehrere Typen des Kurzdarmsyndroms. Diese beeinflussen maßgeblich, wie schwer die Auswirkungen auf die Nährstoffaufnahme sind:
- Jejunum-Stoma-Typ: Dünndarm mündet direkt als Stoma aus (kein Dickdarmanteil mehr vorhanden)
- Jejunum-Kolon-Typ: Teile des Dickdarms sind erhalten – sie können teilweise Flüssigkeit und Elektrolyte über die Schleimhaut aufnehmen
- Jejunum-Ileum-Typ: Abschnitte des unteren Dünndarms (Ileum) sind noch vorhanden – hier besteht das größte Potenzial für Anpassung (Adaptation)
Hinweis: Mehr zu den einzelnen Formen findest du unter: www.kurzdarmsyndrom.at
Leben mit einem Kurzdarmsyndrom
Ein Kurzdarmsyndrom beeinflusst den Alltag der Betroffenen stark. Die wichtigsten Herausforderungen sind:
- Flüssigkeitsverlust
- Nährstoffmangel (z. B. Vitamin B12, Eisen, Zink)
- Stark erhöhte Stuhlfrequenz oder Durchfälle
- Müdigkeit und Abgeschlagenheit
- Abhängigkeit von künstlicher Ernährung (parenteral oder enteral)
Die Therapie zielt darauf ab, die Restfunktion des Darms optimal zu nutzen, Beschwerden zu lindern und die Lebensqualität zu verbessern. Viele Betroffene benötigen vorübergehend oder dauerhaft parenterale Ernährung (über eine Vene), um ausreichend mit Energie, Nährstoffen und Flüssigkeit versorgt zu sein.
Hinweis: Ein Teil des Darms kann sich jedoch im Laufe der Zeit funktionell anpassen (Adaptation). Mit der richtigen Behandlung ist es möglich, die künstliche Ernährung zu reduzieren oder sogar ganz darauf zu verzichten.
Ernährung beim Kurzdarmsyndrom
Die Ernährung spielt eine zentrale Rolle – sie wird individuell angepasst und hängt von der Länge und Funktion des verbleibenden Darms ab.
Wichtige Grundsätze:
- Mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt
- Hochkalorische, fettarme Kost mit ausreichend Eiweiß
- Viel trinken – aber in kleinen Portionen und idealerweise in Kombination mit Elektrolyten
- Vermeidung von Zuckeralkoholen, da sie abführend wirken
- Bei Bedarf: Spezielle Trinknahrung, Elektrolytlösungen oder Vitaminpräparate
Eine diätologische Begleitung ist entscheidend, um Mangelzustände zu verhindern und eine ausgewogene Ernährung sicherzustellen.
Tipp: Führe ein Ernährungstagebuch! So kannst du Unverträglichkeiten und Symptome besser beobachten und gemeinsam mit dem Behandlungsteam Anpassungen vornehmen.
Detaillierte Ernährungstipps findest du auch auf www.kurzdarmsyndrom.at
Parenterale und Enterale Ernährung
Beim Kurzdarmsyndrom infolge Chronisch Entzündlicher Darmerkrankungen (CED) sind enterale und parenterale Ernährungsformen in einigen Fällen essenzielle Bestandteile der Therapie, um den Nährstoffbedarf zu decken und einer Mangelernährung vorzubeugen.
Enterale Ernährung:
Erfolgt über Sonde (z B. Nasensonde, PEG): Wenn normale orale Aufnahme nicht ausreicht oder bestimmte Darmabschnitte geschont werden müssen.
Auch Trinknahrung zählt zur enteralen Ernährung, wenn orale die Zufuhr der Nahrung noch möglich ist.
Parenterale Ernährung:
Wird intravenös verabreicht, wenn der Verdauungstrakt vollständig umgangen werden muss – z. B. bei Darmversagen.
Nur unter ärztlicher Aufsicht, meist im stationären Rahmen oder über spezialisierte ambulante Versorgung.
Dein Netzwerk zählt – nicht nur medizinisch!
Nach der Diagnose Kurzdarmsyndrom fühlen sich viele Menschen verunsichert und überfordert. Umso wichtiger ist es, ein starkes medizinisches und soziales Netzwerk aufzubauen. Dazu gehören:
- Fachärzt:innen (Gastroenterologie, Ernährungsmedizin)
- Diätolog:innen
- Pflegefachkräfte
- Psychologische Betreuung
- Angehörige und Selbsthilfegruppen
Empfehlenswerte Anlaufstellen:
- ÖMCCV (Österreichische Morbus Crohn Colitis ulcerosa Vereinigung): www.oemccv.at
- Die Chronischen Experten (Kurzdarm-Patientenorganisation): www.chronisch.at
- Plattform Kurzdarmsyndrom mit Infos, Videos und Downloads: www.kurzdarmsyndrom.at


Hinweis:
Die Inhalte auf dieser Seite wurden in Zusammenarbeit mit medizinischen Expert:innen und mit freundlicher Unterstützung der Takeda Pharma Ges.m.b.H. erstellt.